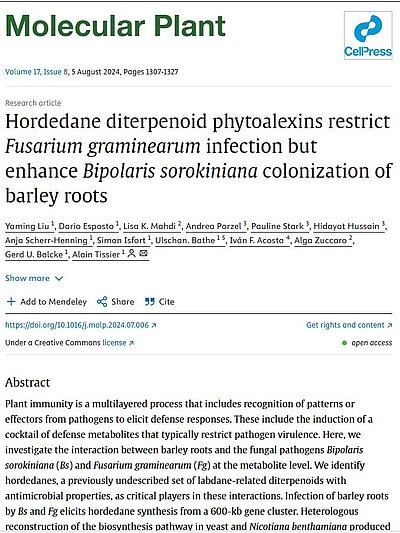Metabolisches Wettrüsten zwischen Pflanze und Pilz: Gerstenpathogen bricht pflanzlichem Speer die Spitze ab.
Pflanzenpathogene Pilze stellen eine große Bedrohung für landwirtschaftliche Erträge dar, die durch die Erwärmung der nördlichen Hemisphäre auch in unseren Breiten zunehmend an Bedeutung gewinnt. IPB-Wissenschaftler/innen haben nun, gemeinsam mit Partnern der Universität Köln, die Interaktionen der Gerstenwurzel mit den Pilzen Bipolaris sorokiniana und Fusarium graminearum beleuchtet. Die beiden Krankheitserreger attackieren vor allem einkeimblättrige Kulturpflanzen: Während F. graminearum die Ähren von Weizen und Gerste befällt und dort für verschrumpelte Körner sorgt, löst B. sorokiniana bei beiden Pflanzen Blattfleckenkrankheiten und Wurzelfäule aus. Bipolaris ist in warmen Gegenden weit verbreitet und wandert langsam nordwärts.
Bei Befall mit den beiden Erregern werden in der Gerste (Hordeum vulgare) eine Reihe von Genen exprimiert, die für verschiedene Biosynthese-Enzyme von Abwehrstoffen codieren. Ein Großteil dieser Gene war von den Hallenser Wissenschaftlern bereits in früheren Arbeiten identifiziert und kloniert worden. In ihrer aktuellen Studie konnten sie nun mittels Massenspektrometrie die von diesen Enzymen produzierten Abwehrmetaboliten in den Wurzeln und Wurzelexsudaten der infizierten Gerstenpflanzen nachweisen. Dabei handelt es sich um Diterpene vom Cleistanthan-Typus – eine Stoffgruppe, deren Vertreter nun erstmals auch in der Gerste als Phytoalexine beschrieben werden konnten. Gerste ist demnach ebenso in der Lage Diterpen-basierte Phytoalexine zu bilden, wie Mais und Reis. Die neuartige Stoffklasse dieser Gersten-Phytoalexine wurde von den Wissenschaftlern Hordedane genannt. Insgesamt konnten sie 17 verschiedene Hordedane in den Wurzeln der infizierten Gerste nachweisen.
Durch Expression der entsprechenden Diterpenproduktionsgene in Hefe und Nicotiana benthamiana konnten die Wissenschaftler die Biosynthese der Hordedane in Hefe rekonstruieren. Neun der 17 aus den Gerstenwurzeln isolierten Hordedan-Verbindungen wurden durch diesen Ansatz auch in Hefe produziert, was für die Korrektheit der rekonstruierten Biosynthesewege spricht. Die Kenntnis der an diesen Stoffwechselwegen beteiligten Gene erlaubte das gezielte Ausknocken dieser Gene in der Gerste; es entstanden also Mutanten, die nicht mehr in der Lage sind, Hordedan-Abwehrstoffe zu bilden. Eine Infektion dieser abwehrgeschwächten Mutanten mit den beiden Krankheitserregern hätte demnach ein ungebremstes Wachstum dieser Pflanzenpathogene zur Folge. Das war aber nur bei Fusarium graminearum der Fall. Interessanterweise zeigte der Pilz Bipolaris sorokiniana eher eine reduzierte Kolonisierung der Gerstenmutanten, obgleich diese keine fungiziden Abwehrstoffe mehr produzierten. B. sorokiniana scheint also die ursprünglich zu seiner Vertreibung produzierten Hordedan-Phytoalexine für sein Gedeihen zu benötigen.
Dieser überraschende Befund konnte von den Hallenser Wissenschaftlern auch in vitro nachgewiesen werden. Dafür untersuchten sie in einem Bio-Assay die Wirkung der prominentesten Hordedanverbindung 19-β-Hydroxy-Hordetriensäure (19-OH-HTA) auf die beiden Pflanzenpathogene, sowie auf drei weitere schädliche und nützliche Pilzarten. Im Ergebnis zeigten alle getesteten Pilzarten, bis auf Bipolaris sorokiniana, nach Behandlung mit 19-OH-HTA erhebliche Störungen in der Sporenkeimung und im Hyphenwachstum. Die Hordedanverbindung ist demnach ein Breitspektrumantimykotikum – nur auf B. sorokiniana wirkt sie nicht, sondern aktiviert im Gegenteil die Sporenkeimung leicht und das Hyphenwachstum des Erregers stark.
In weiterführenden Untersuchungen stellten die Wissenschaftler fest: Bipolaris sorokiniana ist in der Lage 19-OH-HTA zu oxidieren und mit pilzeigenen Sesquiterpenen zu konjugieren. Transkriptomanalysen von Bipolaris-Kulturen mit und ohne 19-OH-HTA-Zusatz zeigten zudem eine starke Herunterregulierung jener Gene, die bei zell-lytischen Prozessen eine Rolle spielen. Bipolaris sorokiniana ernährt sich als hemibiotrophes Pathogen zunächst von lebenden Pflanzenzellen und geht dann in eine nekrotrophe Phase über. Die Inaktivierung der Gene mit zell-lytischer Funktion könnte dazu beitragen, dass dieser Übergang zur nekrotrophen Phase verzögert wird und der Erreger sich weiterhin im lebenden Gewebe vermehren kann.
In dieser sehr umfassenden Studie zeigen die Hallenser Wissenschaftler eindrucksvoll, wie ein Krankheitserreger das Immunsystem der Pflanze nicht nur umgeht, sondern sogar benutzt, um seine Besiedlung zu erleichtern. Der Erreger bricht dem pflanzlichen Speer die Spitze ab und gebraucht sie zum eigenen Wachstum. Die Arbeit veranschaulicht deutlich, dass die Interaktionen zwischen Pathogenen und ihren Pflanzenwirten sehr komplex sind und evolutionsgetrieben zu immer wieder neuen Gegenschlägen von beiden Seiten führt.