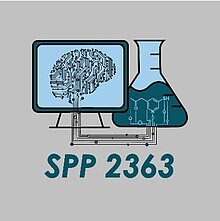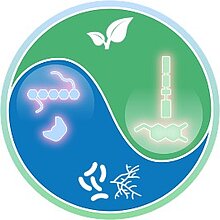Verbundprojekte als Partner
DIP – DiPlanD
Nachhaltig erzeugtes, veganes Vitamin D3 und Cholesterol aus Nierembergia repens
Die wachsende Nachfrage nach nachhaltig erzeugten pflanzenbasierten Wirkstoffen bietet ein beträchtliches Innovations- und Marktpotenzial. Ziel des Projektes DiPlanD ist es, die regionalen Expertisen in den Bereichen Pflanzenzüchtung, Bioverfahrenstechnik, Digitalmess- und Steuerungstechnik und der Wirkstoffanalyse zu bündeln und Nierembergia (N.) repens als neue Agrarpflanze in der Modellregion Südliches Sachsen-Anhalt zu etablieren, um sie als Quelle für pflanzliches Vitamin D3 und Cholesterol für die pharmazeutisches und kosmetische Industrie zu nutzen. N. repens zeichnet sich durch einen außergewöhnlichen hohen Gehalt an Provitamin D aus, zeigt ein rasches Wachstum, ist bereits in Deutschland als Zierpflanze etabliert, und ist hinsichtlich der Bodeneigenschaften relativ anspruchslos. Es ist geplant, die Sterole aus besonders vielversprechenden N. repens-Akzessionen und -Kultivaren mittels bioverfahrenstechnischer und digital-gesteuerter Technologie in biologisch wirksames veganes Vitamin D3 und andere potenziell vermarktungsfähige Sterole zu überführen. Nach einem optimierten Extraktions- und Isolationsverfahren sollen sie als Rohstoff der weiterverarbeitenden Industrie zu Verfügung gestellt werden. Mit DiPlanD wird eine neue Wertschöpfungskette aus einer bislang nur als Zierpflanze genutzten Art in der Modellregion Mitteldeutschland generiert und neue Arbeitsplätze in den Bereichen Anbau, maschineller Ernte, Weiterverarbeitung und Endprodukterzeugung generiert.
Der Beitrag des IPB umfasst die Kultivierung von N. repens-Akzessionen, deren Ernte in unterschiedlichen Altersstadien (getrennt nach Pflanzenorganen) und die Entwicklung von Verfahren zur Extraktion/Isolierung von 7-Dehydrocholesterol (und Cholesterol) und weiterer D-Vitamere, die auch für scale-up Prozesse geeignet sind. Nach der UV-B-induzierten Umsetzung zu Vitamin D3 werden auch entstanden Nebenkomponenten (z.B. Lumichrome) separiert und deren Identität mittels spektroskopischer Methoden geklärt.
Förderung: BMBF
Teil des Forschungsverbundes: DiP Sachsen-Anhalt Modellregion der Bioökonomie /Digitalisierung in pflanzlichen Wertschöpfungsketten (https://www.dip-sachsen-anhalt.de/ )
Förderzeitraum IPB: 04/2024 – 08/2027
Koordinator: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Prof. Dr. Gabriele Stangl)
Partner: Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie, Abt. Natur- und Wirkstoffchemie; Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften (Prof. Dr. Gabriele Stangl); Julius Kühn-Institut, Institut für Züchtungsforschung an gartenbaulichen Kulturen (Prof. Dr. Frank Marthe); Gesellschaft zur Förderung von Medizin, Bio- und Umwelttechnologie, Fachsektion Umweltbiotechnologie (Dipl.-Ing. Matthias Leifheit); Abteilung Technologieökonomik und -management des Fraunhofer-Zentrums für Internationales Management und Wissensökonomie (Dr. Daniela Pufky-Heinrich)
Ansprechpartner am IPB: Dr. Norbert Arnold
DFG Sonderforschungsbereich 1664
Plant Proteoform Diversity
Durch die parallele Sequenzierung natürlicher Akzessionen in Pflanzenpopulationen wurde eine Fülle von DNA-Sequenzvariationen entdeckt, darunter die besonders auffällige Art von Variation: der so genannte Einzelnukleotidpolymorphismus (SNP). Obwohl die Beziehungen zwischen Genen und Merkmalen weitgehend bekannt sind, steht unser Verständnis der Auswirkungen allelischer Variationen auf die Funktion einer bestimmten spezifischen Proteoform, die letztlich für die Umsetzung genetischer Variation in die beobachtete phänotypische Variation verantwortlich ist, noch am Anfang. SNP2Prot verfolgt das Ziel, die Übersetzung von genomisch kodierten Sequenzvariationen in strukturelle, mechanistische und funktionelle Proteoformvielfalt zu verstehen. In diesem SFB ermöglicht die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen (molekularer) Pflanzenforschung und Proteinforschung die Aufklärung und schließlich die Vorhersage, wie ein Großteil natürlich vorkommender genetischer Variation mechanistisch in die Manifestation phänotypischer Merkmale mündet. Das IPB ist mit 7 Projekten an diesem Sonderforschungsbereich beteiligt.
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Förderzeitraum: seit 2024
Koordinator: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Sprecher: Prof. Dr. Marcel Quint
Partner: Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB), Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), Universität Leipzig
Ansprechpartner am IPB: Prof. Tina Romeis
Webseite: https://snp2prot.uni-halle.de/
SAW-Projekt GreenProtect
Ein nachhaltiges Freisetzungssystem zur Erzeugung gesünderer Lebensmittel mit weniger Pestiziden
Im Leibniz-Transferprojekt Green-Protect werden Erkenntnisse aus Materialwissenschaften, Chemie und Biotechnologie zusammengebracht, um neue Lösungsansätze für eine Reduzierung von Fungiziden und Herbiziden in der Landwirtschaft zu finden. Dafür sollen biologisch abbaubare Wirkstoffcontainer, sogenannte Mikrogele, entwickelt werden, die mit Düngemitteln oder Pestiziden beladen werden können und eine gezielte Wirkstofffreisetzung an gewünschte Pflanzenorgane erlauben. So kann die Wirkstoffmenge und die benötigten Applikationszyklen signifikant reduziert werden. Nach der Sicherstellung der wissenschaftlichen Konzepte soll ein Technologietransfer bis hin zur kommerziellen Umsetzung erfolgen.
Förderung: Leibniz-Wettbewerb
Förderzeitraum: seit 2023
Koordinator: Leibniz-Institut für Interaktive Materialien (DWI), RWTH Aachen
Partner: Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB)
Ansprechpartner am IPB: Dr. Mehdi Davari, Prof. Ludger Wessjohann
Webseite: https://www.dwi.rwth-aachen.de/projekt/greenprotect
DFG-Schwerpunktprogramm SPP 2363
Nutzung und Entwicklung des maschinellen Lernens für molekulare Anwendungen - Molekulares maschinelles Lernen
Künstliche Intelligenz gehört unbestreitbar zu den sich am schnellsten entwickelnden und gefragtesten Themen unserer Zeit. Ziel des SPP2363 ist es, moderne Algorithmen des Maschinellen Lernens (ML) zu entwickeln und auf molekulare Probleme anzuwenden. Mit dieser Technologie sollen in Zukunft Moleküle mit bestimmten Eigenschaften und Aktivitäten vorgeschlagen, Reaktionen selbstständig entwickelt und optimiert sowie analytische Daten sekundenschnell ausgewertet und interpretiert werden. Die entwickelten Anwendungen sollen in einfach zu bedienende Software-Suiten umgesetzt und experimentell arbeitende Wissenschaftler daran geschult werden. Um das gesamte verfügbare Wissen zu nutzen, ist es notwendig, die bestehenden innovativen Bemühungen in den Bereichen Biochemie, Chemie, Informatik, Mathematik und Pharmazie zu vereinen. Dieses Programm wird die KI-Strategie der Bundesregierung erfüllen und kann Deutschland international als einen führenden Standort für molekulares maschinelles Lernen etablieren.
Teilprojekt am IPB:
Maschinelles Lernen zur schnelleren Entwicklung und Adaptation von Enzymen für schwierige chemische Reaktionen (MacBioSyn). Teil I: Lösungen für regioselektive Oxidationsreaktionen mit 2OGD-Oxidasen
Biokatalytische Synthesestrategien werden von der Europäischen Kommission als eine der Hauptkomponenten einer zukünftigen biobasierten nachhaltigen Wirtschaft (Green Deal) angesehen. Das volle Potenzial dieser Technologie kann jedoch derzeit aufgrund des limitierten Zugangs zu passenden Enzymen nicht ausgeschöpft werden. 2-Oxoglutarat-abhängige (2OGD) Proteine stellen eine bisher wenig bearbeitete Superfamilie von Enzymen dar, die viele „schwierige“ oxidative Reaktionen (u.a. Oxidation nichtaktivierter Kohlenstoffatome) katalysieren. Da solche Reaktionen oft nur schwer chemosynthetisch durchführbar sind, stellt die Nutzung von 2OGD-Enzymen eine lohnende regio- und produktspezifische Alternative zu derartigen traditionellen Verfahren dar. Somit eröffnet die Identifizierung neuartiger Enzyme mit verbessertem Substratspektrum neue Möglichkeiten z.B. in der Naturstoffchemie. Im hier vorgestellten Projekt MacBioSyn soll eine universell nutzbare Plattformtechnologie erstellt werden, die über ML (d.h. mehrschichtiges, aktives und bestärkendes Lernen) eine Vorhersage der Aktivität und der Substrat- und Reaktionsspezifität von Enzymen ermöglicht. Dazu wird eine in silico-Methode zur ML-basierten Analyse von Sequenz-Substratpaaren erzeugt werden, die mit experimentellen Daten trainiert werden wird. Das Projekt basiert auf einem synergistischen Ansatz und vereint die Expertisen für computergestütztes Design/Modelling (Davari) und Hochdurchsatz(HD)-Screening von Enzymen (Dippe, Wessjohann).
Förderung: DFG
Förderzeitraum: seit 2022
DFG-Projektnummer: 460865652, 497207454
Partner: Prof. Jean Loup Faulon, Micalis Institute FR
Ansprechpartner am IPB: Dr. Mehdi Davari, Dr. Martin Dippe, Prof. Ludger Wessjohann
Projektwebseite: https://www.uni-muenster.de/SPP2363/
SFB Transregio TRR356
Genetische Diversität, die biotische Interaktionen von Pflanzen gestaltet (PlantMicrobe)
Mikroorganismen können Pflanzengesundheit fördern oder schädigen. Symbiontische Mikroben versorgen Pflanzen mit Nährstoffen und verbessern so ihre Gesundheit und Erträge, während Pathogene vollständige Ernteausfälle hervorrufen können. Investitionen in eine nachhaltige, wissenschaftsbasierte Verbesserung der Pflanzengesundheit sind daher unerlässlich. Die LMU München, die TU München und die EKU Tübingen haben drei international sichtbare Kompetenzzentren zu biotischen Interaktionen von Pflanzen aufgebaut. Durch die Zusammenführung dieser Hotspots entsteht TRR356 mit der langfristigen Vision, Pflanzengesundheit mit neuartigen genetischen Ressourcen, Protokollen und Werkzeugen zu verbessern.
Die physische Kontaktzone zwischen Wirtspflanzen und infizierenden Mikroben unterliegt ständiger molekularer Kommunikation, die zur Koevolution von Infektions- und Verteidigungsstrategien führt. Die Akteure, die das Ergebnis dieser Begegnung bestimmen - chemische Signale, Nährstoffflüsse, Makromoleküle und/oder Toxine - sind evolutionären Veränderungen unterworfen. Die daraus resultierende Vielfalt genetischer Determinanten der biotischen Interaktionen von Pflanzen ist eine wertvolle Ressource, für die Entdeckung neuer Gene und ihrer Varianten sowie für das Verständnis ihrer Funktion und ihrer gezielten Nutzung zur Verbesserung der Symbiose und Pathogenabwehr.
Teilprojekt am IPB
Rezeptor Kinasen sind modulare Proteine, die Pflanzenzellen befähigen deren Umgebung zu überwachen und auf die vorherrschenden Gegebenheiten zu reagieren. Drei Arabidopsis SymRK Homologous Receptor-like Kinase (AtSHRK) Paraloge sind an der Interaktion mit dem obligat biotrophen Oomyzeten und Erreger des falschen Mehltaus, Hyaloperonospora arabidopsidis, beteiligt. In diesem Projekt sollen die mechanistischen Details und funktionellen Unterschiede der SHRK-vermittelten Signalweiterleitung im Kontext unterschiedlicher Pflanzen-Pathogen Assoziationen untersucht, und so das Verständnis der Rolle von SHRKs in biotischen Interaktionen vergrößert werden.
Förderung: DFG
Förderzeitraum: seit 2023
DFG-Projektnummer: 491090170
Antragsteller: LMU München (Koordinator), TU München, EKU Tübingen
Ansprechpartner am IPB: Dr. Martina Ried
Projektwebseite: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/518022295?language=de
POSADEC
Das verborgene Potenzial südamerikanischer Cortinarien
Südamerikanische Nothofagaceae-Wälder beherbergen einzigartige, endemische Baumarten, die die ältesten Linien der Nothofagus-Evolution repräsentieren. Ektomykorrhizapilze entwickeln sich gemeinsam mit dem assoziierten Pflanzenpartner, doch die mutualistischen Pilze sind in diesen Gebieten noch weitgehend unerforscht. Unsere früheren Studien haben gezeigt, dass die Vielfalt der unbekannten dermocyboiden Cortinarii dort sehr groß ist und sich in einer großen Vielfalt an Chemotypen (Pigmenten) widerspiegelt. Die Pigmente der dermocyboiden Cortinarius-Arten basieren auf (Prä-)Anthrachinonen, einer der vielversprechendsten Klassen von natürlichen Photosensitizern (PS). Eine systematische Untersuchung der photobiologisch aktiven Pigmente ist notwendig, um die ökologische Funktion solcher Pigmente zu verstehen. Eine gründliche taxonomische Untersuchung ist unerlässlich, da chemische und pharmakologische Analysen auf eindeutig definierten Taxa und klar identifizierten Belegen beruhen müssen.
Die Verknüpfung der biologischen Vielfalt mit der Vielfalt der Verbindungen und Funktionen ist ein einfacher Ansatz, der eine effiziente und erfolgreiche Entdeckung neuer Arten, neuer Verbindungen und neuer PS ermöglicht. Molekulare Netzwerkanalysen werden als höchst innovatives metabolomisch-taxonomisches Instrument eingesetzt und auf der Grundlage einer Multi-Gen-Phylogenie und klassischer morphologischer Methoden getestet. Dies wird dazu beitragen, die Lücken in den basalen Cortinarius-Linien auf globaler Ebene zu schließen und die Evolution der Sekundärmetaboliten besser zu verstehen. Neue Pigmente werden entdeckt, isoliert und identifiziert. Photoaktive Pigmente werden auf ihre biologische Aktivität getestet, wobei der Schwerpunkt auf der gezielten Lichtaktivierung liegt.
Förderung: DFG & FWF (WEAVE-Programm)
Förderzeitraum: 2022-2026
DFG-Projektnummer: 491871566
Partner: Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie, Abt. Natur- und Wirkstoffchemie,
Universität Innsbruck, Institut für Mikrobiologie (Ansprechpartner Prof. Dr. Ursula Peintner),
Universität Innsbruck, Institut für Pharmazie (Ansprechpartner Dr. Bianka Siewert)
Ansprechpartner am IPB: Dr. Norbert Arnold
Projektwebseite: https://www.uibk.ac.at/de/microbiology/forschung/projekte/posadec/
GLACIER
German-Latin American Centre of Infection & Epidemiology Research & Training
Das multidisziplinäre Konsortium GLACIER zielt darauf ab, die Prävention und Behandlung übertragbarer Krankheiten sowie die Entwicklung neuer Impfstoffe und Therapieverfahren zu stärken. Auch soll die Krisenvorsorge, -reaktion und -nachsorge verbessert werden. GLACIER wird unter gemeinsamer Führung des Instituts für Medizinische Immunologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) im Verbund mit dem Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB) und dem Institut für Virologie der Charité - Universitätsmedizin Berlin betrieben. Zentrale Partnerinstitutionen in Mittelamerika sind die führenden Universitäten der Region, die Universität Havanna (UH) und die Unabhängige Nationaluniversität von Mexiko (UNAM), an denen jeweils zentrale Forschungs- und Ausbildungslabore entstehen. Die internationale und transdisziplinäre Dimension der Pandemievorsorge und -bekämpfung wird zudem durch 35 Partner in insgesamt 8 Ländern Mittelamerikas und fünf weiteren Expertengruppen aus Deutschland verstärkt. GLACIER will darauf hinwirken, Kapazitäten in der lateinamerikanischen Region zu stärken, indem es (i) als Think-Tank dient, der ein multidisziplinäres Netzwerk von Institutionen in acht zentralamerikanischen Ländern unterstützt, (ii) zum Aufbau lokaler Forschungskapazitäten beiträgt, (iii) die Anzahl gut ausgebildeter Experten/Wissenschaftler und Ausbilder erhöht und (iv) regionale und internationale politische Entscheidungsträger einbezieht, was die Verbreitung von Informationen und eine schnellere regionale Krisenreaktion ermöglicht.
Hauptmaßnahmen:
- Entwicklung einer One-Health Summer School
- Einrichtung von Reallaboren in Mexiko und Kuba
- Promotions- und Forschungsaufenthalte und bilaterale Doktorandenprogramme
- Einrichtung eines Datenbank-Tools für Surveillance und Bioactives
- Entwicklung einer Seminarreihe über interdisziplinäre Ansätze zur Behandlung und Kontrolle von Infektionskrankheiten
- Entwicklung von Lehrmodulen zu antiinfektiven Behandlungsstrategien und zur bio-sozialen Analyse von Infektionskrankheiten
Förderung: DAAD
Förderzeitraum: 2021-2025
Partner:
Universidad de La Habana
Universidad Nacional Autónoma de México
Institut für Virologie der Charité - Universitätsmedizin Berlin
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Leibniz Institut für Pflanzenbiochemie (IPB)
Institut für Geschichte der Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen
Friedich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Tierärztliche Hochschule Hannover
Institut für Molekulare Virologie der Universität Ulm
German Institute for Global and Area Studies (GIGA)
Ansprechpartner am IPB: Prof. Ludger Wessjohann
Webseite: https://glacierproject.org/de/
DFG-Graduiertenkolleg (GRK) 2670
Amphiphilie Plus: Selbstorganisation weicher Materie durch multiple nicht-kovalente Wechselwirkungen (BEAM)
Amphiphilie ist ein qualitatives Konzept zur Beschreibung der Selbstanordnung von Molekülen mit hydrophilen und hydrophoben Bestandteilen in wässerigen Lösungen. Polyphile Moleküle sind solche kleinen oder Makro-Moleküle, die ein Interaktionsmuster aufweisen mit mindestens zwei nichtkovalenten Wechselwirkungen, von denen eine auf Amphiphilie basiert. Durch solche nichtkovalenten Interaktionsmuster untereinander, mit Lösemitteln, anderen (Bio-)Molekülen und Grenzflächen, lässt sich selbstangeordnete Weiche Materie hoher Komplexität schaffen. Ziel dieses Graduiertenkollegs ist es, aus der großen Zahl an bekannten Effekten von nichtkovalenten Wechselwirkungen ein modernes, forschungsorientiertes Lehrprogramm zu entwickeln. Damit soll das Verständnis der Entstehung von Komplexität in molekularen Systemen verbessert und Design-Prinzipien zur Erzeugung nanostrukturierter Materialien durch Nutzung multipler nichtkovalenter Wechselwirkungen entdeckt werden.
Aus der Ausbildungs- und Lehrperspektive baut das Forschungsprogramm über komplexe Strukturbildung Weicher Materie auf dem eingängigen und vermeintlich einfachen Konzept der Amphiphilie als Startpunkt auf. Die Interaktionsmuster von Amphiphilie werden dann mit anderen Wechselwirkungen erweitert. Dieses GRK kombiniert die vorhandenen Expertisen in Simulation, Design und Synthese, Charakterisierung und letztlich dem Verständnis neuer Materialien und ihrer Eigenschaften. Das Forschungs- und Lehrkonzept bietet den Promovierenden eine durch besondere Tiefe und Breite ausgezeichnete Kombination moderner chemischer, physikalischer und mathematischer Methoden.
Förderung: DFG (Projektnr. 436494874)
Förderzeitraum: seit 2021
Koordinator: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Ansprechpartner: Prof. Dariush Hinderberger (Koordinatorin: Dr. Imme Sakwa-Waltz)
Partner: Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB)
Ansprechpartner am IPB: Jun.-Prof. Martin Weissenborn
Webseite: https://beam.uni-halle.de
DFG-Graduiertenkolleg (GRK) 2498
Kommunikation und Dynamik pflanzlicher Zellkompartimente
Der wissenschaftliche Fokus des RTG2498 liegt auf der Dynamik und Kommunikation pflanzlicher Zellkompartimente, wie Plastiden oder Zellkerne, die die Eigenschaften einer Pflanzenzelle maßgeblich beeinflussen. Die einende Arbeitshypothese dieses GRKs ist, dass die Kontrolle wichtiger physiologischer Prozesse der pflanzlichen Entwicklung oder der Anpassung an Umweltstresse die koordinierte Funktion von Organellen voraussetzt. Bisherige Studien pflanzlicher Zellkompartimente haben sich v. a. auf einzelne Organellen konzentriert, so dass über deren Struktur, Funktion und Biogenese umfangreiche Informationen zur Verfügung stehen. Im Gegensatz dazu wurde die Interaktion und Koordination verschiedener Kompartimente in der Pflanzenzelle bisher nur wenig untersucht. Das GRK konzentriert sich daher auf Prozesse, die Plastiden, den Zellkern und ausgewählte andere wichtige Zellkompartimente verknüpfen, um die grundsätzliche Frage zu klären, wie pflanzliche Zellkompartimente entsprechend den zellulären Bedürfnissen miteinander kommunizieren und dynamisch miteinander assoziieren und interagieren. Der Fokus auf Prozesse, die ein oder mehrere Organellen verbinden, ermöglicht den notwendigen nächsten Schritt hin zu einem besseren Verständnis der wechselseitigen Abhängigkeiten zellulärer Kompartimente mit wichtigen Funktionen in der pflanzlichen Physiologie.
Der Forschungsgegenstand ist hervorragend geeignet für einen kooperativen Forschungsansatz, der unter Beteiligung mehrerer Arbeitsgruppen die Beziehungen zwischen den Organellen herausarbeitet. Das Qualifizierungsprogramm für die Promovierenden dieses GRKs sorgt dafür, dass sie mit verschiedenen experimentellen Herangehensweisen in Kontakt kommen, die von den beteiligten Arbeitsgruppen vertreten werden. Die große Bandbreite alternativer experimenteller Ansätze wird durch zusätzliche Ausbildungskomponenten ergänzt, die den Doktorandinnen und Doktoranden helfen werden, ihre eigenen wissenschaftlichen Profile weiterzuentwickeln und zu schärfen. Effektive und erfolgreiche Forschung wird durch Betreuungskomitees, durch die Organisation und Beteiligung an regelmäßigen Progress- und Literaturseminaren sowie durch Workshops sichergestellt.
Förderung: DFG (Projektnr. 400681449)
Förderzeitraum: seit 2019
Koordinator: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Ansprechpartner: Prof. Ingo Heilmann (Koordinatorin: Kristin Leimer)
Partner: Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB)
Ansprechpartner am IPB: Prof. Dr. Bettina Hause, Prof. Dr. Steffen Abel, Dr. Debora Gasperini
Webseite: https://rtg2498.uni-halle.de/
DFG-Graduiertenkolleg (GRK) 2467
Intrinsisch ungeordnete Proteine – Molekulare Prinzipien, zelluläre Funktionen und Krankheiten
Intrinsisch ungefaltete Proteine (intrinsically disordered proteins, IDPs) oder ungefaltete Protein-Regionen (intrinsically disordered regions, IDRs), bei denen keine definierten Strukturmerkmale nachweisbar sind, nehmen etwa 40% der Proteome höherer Eukaryoten ein. Viele dieser flexiblen Proteine und Proteinregionen sind bis heute wenig untersucht, obwohl sie wichtige Funktionen bei der Regulation biologischer Prozesse und beim Aufbau dynamischer biologischer Superstrukturen, wie beispielsweise der Bildung membranloser Organellen, erfüllen.
Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger, erfolgreicher Proteinforschung in Halle an der Saale und dem zunehmend großen Interesse an IDPs/IDRs sollen diese Protein im Rahmen des interdisziplinären Graduiertenkollegs bestehend aus Biochemikern, Biophysikern und Zellbiologen untersucht werden. Die komplementären wissenschaftlichen Expertisen erlauben die in vitro-Charakterisierung bis hin zur Untersuchung von IDPs/IDRs in Zellen, mit Schwerpunkt auf der Untersuchung von IDP/IDR-Wechselwirkungen mit Proteinen und RNA. Alle GRK-Projekte befassen sich mit Schlüsselfragen zu den molekularen Prozessen, die einem einzelnen IDP/IDR erlauben, beispielsweise nach der Bindung an Proteine oder RNA verschiedene Konformationen anzunehmen. Die Teilprojekte werden über eine Aufklärung physikalischer und funktioneller Protein-Protein- und Protein-RNA-Wechselwirkungen hinaus neue Erkenntnisse der molekularen Mechanismen erschließen, die unser Verständnis von intrinsisch ungeordneten Strukturen in zellulären Systemen und Organismen erweitern werden.
Den Mitgliedern des GRK wird ein breites aktuelles Methodenrepertoire, ein kompetitives und attraktives Forschungsumfeld und Karriere-Beratung geboten. Sie profitieren von hochkarätigen Vorlesungen und Workshops, die unter Mitwirkung von internationalen IDP-Experten veranstaltet werden. Darüber hinaus erlernen die Promovierenden in multidisziplinären, internationalen Teams zu kooperieren und ihre Ergebnisse und Fragestellungen mit Forschenden verwandter Fachrichtungen zu kommunizieren.
Förderung: DFG (Projektnr. 391498659)
Förderzeitraum: seit 2019
Koordinator: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Ansprechpartner: Prof. Dr. Andrea Sinz
Partner: Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB)
Ansprechpartner am IPB: Prof. Dr. Tina Romeis
Webseite: https://rtg2467.uni-halle.de/
Diese Seite wurde zuletzt am 25 Mar 2025 29 Oct 2025 30 Jan 2025 10 Dec 2024 04 Feb 2025 18 Jul 2024 10 Dec 2024 04 Feb 2025 22 Aug 2023 10 Dec 2024 04 Feb 2025 22 Aug 2023 10 Dec 2024 04 Feb 2025 22 Aug 2023 10 Dec 2024 04 Feb 2025 12 Dec 2024 27 Feb 2023 10 Dec 2024 04 Feb 2025 18 Jul 2023 10 Dec 2024 04 Feb 2025 25 Jun 2021 10 Dec 2024 04 Feb 2025 12 Sep 2019 10 Dec 2024 04 Feb 2025 14 Jan 2022 10 Dec 2024 04 Feb 2025 05 Nov 2018 geändert.