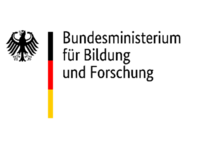Verbundprojekte als Koordinator
Hier finden Sie Beschreibungen von Forschungsverbundprojekten, die vom IPB koordiniert werden bzw. mitgegründet wurden und über eingeworbene Drittmittel finanziert werden.
Entwicklung neuer Adjuvanzien (Booster) zur Impfstoff-Optimierung für ältere Menschen
SeniorBoost ist ein Kooperationsprojekt der Abteilung für Natur- und Wickstoffchemie des Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (Prof. Dr. Ludger Wessjohann) und der Medizinischen Immunologie der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Prof. Dr. Barbara Seliger).
Im höheren Alter nehmen Reaktionsfähigkeit und Funktionalität des Immunsystems ab, weshalb ältere / immundefiziente Personen anfälliger für Infektionen sind. Auch erhöhte Inzidenzen vieler Krebserkrankungen beruhen u.a. auf dem altersbedingten Nachlassen des Immunsystems. Aus diesem Grund sprechen Ältere / immundefiziente Menschen zudem auch schlechter auf "'handelsübliche‘ Impfstoffe und Therapien an. Aufgrund starker Nebenwirkungen werden einige (Tumor)Therapien bei Älteren daher erst gar nicht eingesetzt. Ein wichtiger Grund ist, dass Impfstoffe und Therapeutika nicht explizit für diese Bevölkerungsgruppen entwickelt und klinisch getestet werden, sondern in der Regel für ‘Best Ager‘ (18-60 Jährige). Die Entwicklung von neuen Wirkstoff-Formulaturen mit gesteigerter, patientenspezifischer Wirksamkeit und besserem Sicherheitsprofil ist daher eine Grundvoraussetzung für effizientere und verträglichere Impfungen und Therapien. Somit besteht großer Bedarf an besseren Adjuvanzien, den Wirkverstärkern (Boostern) in Impfstoffen und Therapeutika.
Aus diesem Grund zielt SeniorBoost auf die Identifizierung, chemische Optimierung, Testung und weiterführende Entwicklung hochinnovativer, naturstoffabgeleiteter oder synthetischer Wirkstoffmoleküle ab, die aufgrund herausragender immunmodulatorischer Eigenschaften vielversprechende wirkverstärkende Adjuvanzien für Impfstoffe / Therapien sein können. Unser Adjuvanz-Design basiert auf natürlichen und synthetischen Kohlenhydratstrukturen, welche mittels der am IPB entwickelten Multikomponentenreaktions-Chemie (MCRs) flexibel funktionalisiert werden. Damit verfügen wir über ein robustes, anpassbares Multiplexing-System für die effiziente Synthese solcher Adjuvanzien. Zudem identifizierten wir kürzlich neue, vitaminähnliche, immunstimulierende Naturstoffe als weiteren vielversprechenden Ausgangspunkt des SeniorBoost-Vorhabens.
Förderung: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, EFRE
Förderzeitraum: 07/2025 – 09/2028
Koordinator: Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB), Abteilung Natur- und Wirkstoffchemie
Partner: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizinische Fakultät, Medizinische Immunologie)
Ansprechpartner: Dr. Robert Rennert und Prof. Dr. Ludger Wessjohann
Entwicklung innovativer Medikamente gegen Alterung und Krebs
InMedAK ist ein Kooperationsprojekt der Abteilung für Natur- und Wickstoffchemie des Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (Prof. Dr. Ludger Wessjohann) und der Translationalen Entzündungsforschung der Universitätsmedizin der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Prof. Dr. Inna Lavrik).
Trotz steter Verbesserung der Therapien gegen Krebs, chronische Entzündungs- und altersassoziierte Erkrankungen, bleibt der Bedarf an neuen, effizienteren und nebenwirkungsärmeren Behandlungsoptionen sehr hoch. Die hohe Relevanz des Themas ergibt sich auch dadurch, dass die weltweite demografische Entwicklung (alternde Bevölkerung) und aktuelle Lifestyle-Entwicklungen (Bewegungsmangel, Übergewicht, Stress etc.) zu absehbar steigenden Fallzahlen der o.g. Erkrankungen führen. InMedAK adressiert diesen Bedarf in mehrfacher Hinsicht auf innovative Weise.
Ziel von InMedAK ist die Entwicklung neuartiger Wirkstoffe für Erkrankungen, die auf fehlregulierten Entzündungs- und Stoffwechselprozessen beruhen und stark altersassoziiert sind, z.B. Krebs, Metabolisches Syndrom mit Diabetes oder Neurodegenerationen wie Alzheimer. Durch einen innovativen Ansatz sollen spezielle Apoptose-Mechanismen moduliert und so krankheitsassoziierte Zelltod- und Entzündungswege kontrolliert werden. Hierfür bieten sich Protein-Protein-Interaktionen (PPI) an, die in Vorarbeiten der AG Lavrik identifiziert wurden und nun mit passgenauen Wirkstoffen adressiert werden sollen. Entsprechend suchen, testen und entwickeln wir im Rahmen von InMedAK niedermolekulare Wirkstoffe, die spezifisch auf den tumor- und entzündungsassoziierten extrinsischen Apoptoseweg wirken sollen. Nach unserem Kenntnisstand ist die geplante anwendungsorientierte FuE derzeit konkurrenzlos. Denn im Gegensatz zu Modulatoren des intrinsischen Apoptose-Wegs wurden bis dato noch keine spezifischen Wirkstoffe für den extrinsischen Apoptose-Weg entwickelt.
Förderung: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, EFRE
Förderzeitraum: 04/2025 – 09/2028
Koordinator: Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB), Abteilung Natur- und Wirkstoffchemie
Partner: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizinische Fakultät, Translationale Entzündungsforschung)
Ansprechpartner: Dr. Robert Rennert und Prof. Dr. Ludger Wessjohann
Pflanzliche Wirkstoffe zur Behandlung altersbedingter chronischer Blut-Erkrankungen
BloodCure ist ein Kooperationsprojekt der Abteilung für Natur- und Wickstoffchemie des Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (Prof. Dr. Ludger Wessjohann) und der Medizinischen Immunologie der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Prof. Dr. Barbara Seliger).
Das Vorhaben BloodCure soll die Behandlungsoptionen und damit die Möglichkeit eines weiterhin autonomen und selbstbestimmten Lebens mit chronischen Blut-Erkrankungen, die überwiegend bei älteren Menschen auftreten, erweitern und verbessern, indem wir neue, wirkungsvolle, naturstoffabgeleitete Wirkstoffmoleküle für eine spätere Anwendung als Nahrungsergänzungsmittel (Nutraceuticals) oder - bei starker Wirkung - Arzneimittel entwickeln. Vorteile pflanzlicher Wirkstoffe, gegenüber synthetischen, sind ihre höhere Akzeptanz (Compliance) und leichtere Zulassung, wenn eine traditionelle Verwendung als Nutz-, Heil- oder Gewürzpflanze bekannt ist.
Mit BloodCure suchen und entwickeln wir innovative Wirkstoffe, die zielgenau mutierte Proteine der Blutzellen hemmen sollen. Denn zahlreiche Blut-Erkrankungen, tumorale wie auch nicht-tumorale, werden im Wesentlichen von bereits identifizierten Mutationen zellwachstumsregulierender Proteine ausgelöst, z. B. JAK2, FLT3 oder MPL. Dabei sind sowohl das Auftreten der Mutationen wie auch deren gesundheitlichen Auswirkungen stark altersassoziiert. Die Mutationen bewirken i.d.R. eine pathogene Hyperaktivität von zellwachstumsfördernden Proteinen und sind so häufig zentrale Ursache für die Entstehung einer ganzen Reihe von Blut-Erkrankungen, beispielsweise den sogenannten myeloproliferativen Erkrankungen (MPNs), die sich insbesondere bei älteren Menschen häufen und umgangssprachlich eine Blutfülle, also ein ‘zu viel’ an Blutzellen darstellen. MPNs sind chronische Erkrankungen mit sehr ernsten klinischen Symptomatiken. Zudem haben diese Patienten ein deutlich höheres Risiko im weiteren Krankheitsverlauf eine Leukämie zu entwickeln.
Im Rahmen von BloodCure werden wir neuestes, proteinstrukturelles Wissen nutzen, um gezielt die krankheitsassoziierten, mutierten Zielproteine chemoinformatisch zu modellieren, exakte Pharmakophore der mutierten/zu hemmenden Protein-Bindestellen zu erstellen und diese virtuellen Modelle für das in silico Screening unserer IPB-Naturstoff-Bibliothek zu nutzen, um erste potenziell wirkaktive Naturstoffe als Ausgangspunkt für die weiterführenden biochemischen und zellbasierten in vitro Labortestungen und die Wirkstoffentwicklung zu identifizieren.
Förderung: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, EFRE
Förderzeitraum: 07/2025 – 09/2028
Koordinator: Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB), Abteilung Natur- und Wirkstoffchemie
Partner: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Medizinische Fakultät, Medizinische Immunologie)
Ansprechpartner: Dr. Robert Rennert und Prof. Dr. Ludger Wessjohann
Digital unterstützte Erweiterung der bioökonomischen Wertschöpfung aus der Arzneipflanze Johanniskraut (Hypericum sp.)
Ziel des HyperSpace-Vorhabens ist es, das bioökonomische Potential der Arzneipflanze Hypericum perforatum L. (Johanniskraut) und verwandter Arten auf verschiedenen Ebenen zu entwickeln. Dies umfasst die Identifizierung von neuen Genotypen, Genen, Enzymen, Wirkstoffen und Funktionen, die zur industriellen Produktion von höherwertigen Johanniskrautextrakten aber auch definierten Inhaltsstoffen und prenylierten Derivaten anderer Naturstoffe genutzt werden können (s.a. das Projekt PhenPren. Die geplante Erschließung erfolgt auf der Grundlage der einzigartigen Sammlung von Johanniskräutern des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK).
Das Echte Johanniskraut (Hypericum perforatum L.), das vorrangig zur Behandlung von Depressionen eingesetzt wird, aber auch antibakterielle, krebshemmende und anti-Demenz Eigenschaften besitzt, zählt zu den wichtigen Sonderkulturen in Sachsen-Anhalt.
Das Vorhaben kombiniert die Expertise unterschiedlicher Fachdisziplinen Sachsen-Anhalts und involviert Metabolitencharakterisierung (IPB), Genomanalyse, Transkriptomik, Entwicklungsbiologie und Kultivierung von Johanniskraut (IPK), Digitalisierung der Prozesse (MLU) sowie die sozio- und technoökonomische Evaluierung der Produkte (Fraunhofer IMW). Neben Hypericum-spezifischen Erkenntnissen und Produkten wird weiterhin die Etablierung einer neuen Technologie (SpaceEx) zur räumlich aufgelösten Erfassung von gewebespezifischen Genexpressionsmustern, neuer Agrobacterium-Stämme für die funktionelle Genvalidierung in Pflanzen und einer innovative Plasmid-Sequenzierungsmethode erwartet, die perspektivisch in ein Start-up für Synthetische Biologie in Sachsen-Anhalt münden sollen.
Das Projekt HyperSpace soll somit sowohl den Standort Sachsen-Anhalt für den Anbau, die Züchtung und Forschung im Bereich Arzneipflanzen stärken als auch die stofflich-chemische und biochemische Nutzung und Verarbeitung von pflanzlichen Wirk- und Wertstoffen fördern.
Förderung: BMBF
Teil des Forschungsverbundes: DiP Sachsen-Anhalt Modellregion der Bioökonomie /Digitalisierung in pflanzlichen Wertschöpfungsketten (https://www.dip-sachsen-anhalt.de/ )
Förderzeitraum: 05/2024 - 12/2028
Koordinator: Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB)
Partner: Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK, Dr. Paride Rizzo) Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU, Prof. Ivo Große)
Center for Economics of Materials CEM des Fraunhofer-Zentrums für Internationales Management und Wissensökonomie (IMW, Dr. Daniela Pufky-Heinrich)
Ansprechpartner: Prof. Dr. Ludger A. Wessjohann und Dr. Katrin Franke
Diese Seite wurde zuletzt am 10 Jul 2020 10 Jul 2017 29 Oct 2025 15 Oct 2025 15 Oct 2025 15 Oct 2025 15 Oct 2025 15 Oct 2025 15 Oct 2025 15 Oct 2025 15 Oct 2025 15 Oct 2025 15 Oct 2025 15 Oct 2025 15 Oct 2025 29 Jan 2025 12 Jul 2024 12 Jul 2024 18 Mar 2022 03 Feb 2025 geändert.